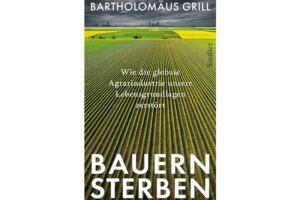Traurig, apathisch und unfähig, den Alltag zu meistern – das sind typische Anzeichen für eine Depression. Die Volkskrankheit hat aber auch positive Effekte, meinen mittlerweile viele Psychologen. So hat eine neue Studie die überraschende Erkenntnis gebracht, dass Depressive bessere Entscheidungen treffen als unbeschwerte Zeitgenossen.
Die Psychologin Bettina von Helversen von der Universität Basel hatte für diese Untersuchung 54 Probanden rekrutiert und in drei Gruppen eingeteilt: psychisch Gesunde, schwer Depressive und Patienten, die auf dem Weg der Besserung waren. In einem Computerspiel sollten die Teilnehmer einen Job an fiktive Bewerber vergeben. Ergebnis: Die Depressiven begutachteten besonders viele Bewerber und wählten dann die am besten Geeigneten aus. Die Gesunden und Genesenden gingen dagegen nicht so gründlich vor.
Frühere Studien hatten gezeigt, dass die intellektuelle Leistungsfähigkeit bei Depressiven sinkt. „Häufig verschlechtern sich Intelligenz und Gedächtnis sowie die Fähigkeit, Führungsaufgaben zu übernehmen“, berichtet Paul Andrews, Evolutionspsychologe an der University of Virginia. Einen Widerspruch sehen die Experten darin nicht. Denn eine geringere kognitive Leistung müsse nicht bedeuten, dass sich die Entscheidungsfähigkeit verschlechtert.
Natürlich ist eine Depression eine große Belastung für jeden, der darunter leidet. Deshalb stellten sich Forscher die Frage: Warum tritt diese psychische Störung seit Menschengedenken in allen Kulturkreisen auf? Schließlich passt das zurückgezogene, grüblerische Verhalten, das bei einer schweren Depression im Suizid enden kann, nicht zum Dogma der Evolution „Survival of the fittest“. Depressionen dürfte es demnach gar nicht geben.
Andrews und seine Mitstreiter vertreten die These, dass Depressionen den Betroffenen einen Überlebensvorteil verschaffen und die entsprechenden Erbanlagen deshalb nicht ausselektiert wurden. „Das endlose und scheinbar zweckfreie Nachsinnen und Analysieren kann helfen, eine schwierige Lebensphase zu bewältigen und sich neue Ziele zu stecken“, meint Andrews. Depressionen träten schließlich auffallend häufig nach einer Scheidung, einem Verlust des Arbeitsplatzes oder einem anderen traumatisierenden Erlebnis auf. In Depressionen ohne erkennbaren äußeren Anlass sieht Andrews hingegen keinen Nutzen.
Der kanadische Psychologe Carsten Wrosch hat 2008 in einer Langzeitstudie mit pubertierenden Mädchen gezeigt, dass eine Depression sie vor schlimmerem Übel bewahren kann. Die Mädchen, die zur Depression neigten, waren besser in der Lage, sich von unerreichbaren Zielen zu trennen. Und das vorübergehende Stimmungstief schützte sie über einen Zeitraum von 19 Monaten vor weiteren psychischen Abstürzen. „Möglicherweise bietet es auch im späteren Leben noch Schutz“, vermutet Wrosch.
Neben solchen Indizien gibt es auch biologische Befunde, die die „Theorie des analytischen Grübelns“ untermauern. Andrews berichtet von einem „Antennenmolekül“ im Gehirn, dem 5-HT1A- Rezeptor, der eine Rolle bei der Entstehung der Depression spielen soll. Dieses Antennenmolekül sorgt für Energienachschub in einer Gehirnregion, die Ablenkungen verhindert – im ventro- lateralen präfrontalen Cortex. „Analysieren verlangt Nachdenken ohne Ablenkung“, erklärt Andrews. Das Gehirn Depressiver sorgt demnach dafür, dass sie Probleme wälzen und größtenteils auch bewältigen.
Andere typische Verhaltensweisen Depressiver wie sozialer Rückzug oder Unlust an Sex hätten ebenfalls den Sinn, dass die Betroffenen nicht vom Grübeln abgelenkt werden. Die Depression sei demnach eine normale Stressreaktion auf widrige Ereignisse und keine Krankheit, die einer Behandlung bedarf.
Diese Einschätzung ruft Kritiker auf den Plan. Martin Brüne, Psychiater an der Ruhr-Universität Bochum, ist skeptisch: „Auf leichte Formen der Depression mag das zutreffen, aber bei klinisch relevanten Depressionen ist das Verhalten der Betroffenen nicht hilfreich im Sinne einer Anpassung.“ Denn bei einer schweren Depression wenden sich die Mitmenschen häufig ab, statt den Leidenden zu unterstützen. Auch die Schweizer Psychologin Bettina von Helversen sieht die depressive Erkrankung nicht als Selektionsvorteil.
Beide Forscher bestreiten nicht, dass Depressionen eine evolutionäre Wurzel haben. Doch sie schätzen die genetischen Anlagen anders ein: Bestimmte Gene würden unter schlechten Bedingungen Depressionen begünstigen, während sie unter guten Bedingungen sogar Vorteile brächten. Eine Variante des sogenannten Serotonin-Transporter-Gens soll seinen Träger beispielsweise anfällig für suizidales und antisoziales Verhalten machen, wenn er in widrigen Verhältnissen aufgewachsen ist. „Wenn ein Mensch mit dieser Gen-Variante aber eine glückliche Kindheit hatte, kann er sogar emotional stabiler und sozial erfolgreicher sein als ein Träger anderer Varianten dieses Gens“, meint Brüne.
Auch bei anderen psychischen Krankheiten wie Schizophrenie oder Bipolarer Störung wird ein evolutionärer Nutzen vermutet. „ Vor allem Verwandte ersten Grades sind überproportional häufig kreativ“, erklärt Neel Burton, Philosoph an der Oxford University. Als prominentes Beispiel gilt Albert Einstein: Während er selbst außergewöhnlich kreativ war, litt sein Sohn Eduard an Schizophrenie.
Anders bei schweren körperlichen Leiden wie Krebs: Sie haben offenbar keinen Nutzen und wurden nur nicht ausselektiert, weil sie meist erst im fortgeschrittenen Alter auftreten, also nach der reproduktiven Phase. Und schwere genetische Krankheiten, die bereits im Kindesalter ausbrechen, deuten Forscher schlicht als „ Fehlkonstruktion“. Der US-amerikanische Psychologe Randolph Nesse mahnt: „Die Schulmedizin muss von der Vorstellung Abschied nehmen, dass der menschliche Körper eine optimal konstruierte Maschine ist.“ ■
von Kathrin Burger