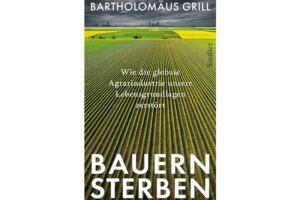Selbst gute Nachrichten können zuweilen Bauchschmerzen bereiten. Etwa dann, wenn Archäologen auf ein Sammelsurium von Vergangenem stoßen und kaum Zeit haben, die Funde zu sichern. „ Sehen Sie die dunklen Flächen auf der Erde? Das sind Spuren von abgebrannten Holzbaracken und Speichergruben“, sagt Rüdiger Krause, Archäologe am Regierungspräsidium Stuttgart, und deutet auf eine Vielzahl von viereckigen Stellen, die sich wie regennasse Flecken vom Untergrund abheben. „Mit so vielen Funden haben wir überhaupt nicht gerechnet“, seufzt er. Seit Juni wird in Welzheim, einem Städtchen nördlich von Schwäbisch Gmünd, gegraben. Auf über 3000 Quadratmetern tritt zu Tage, was die Römer einst von den Germanen trennte: der obergermanisch-rätische Limes – zumindest ein kleiner Teil davon.
Im Zentrum der heutigen Stadt lag ein so genanntes Alen-Kastell, ein römisches Militärlager aus der Mitte des 2. Jahrhunderts. Der größte Teil der ehemals über vier Hektar großen Anlage, die etwa 500 Reitersoldaten beherbergte, ist längst überbaut – von Straßen, Häusern und Vorgärten. Auch der noch frei liegenden Fläche droht die finale Vernichtung. Der benachbarte Automobilzulieferer drängt zur Expansion. Im November rollen die Bagger an und schaufeln die Reste aus der Vergangenheit fort.
Der Baubeginn steht schon lange fest. Daran kann auch der Ehrentitel nicht mehr rütteln, den die Unesco dem obergermanisch-rätischen Limes im Juli verliehen hat: Die Grenzanlage wurde zum Weltkulturerbe erklärt. Neben dem Hadrianswall in Großbritannien steht damit ein zweites Teilstück der ehemaligen römischen Reichsbefestigung unter internationalem Schutz – eine posthume Anerkennung latinischer Leistungen.
Wie ein zerlaufender Tintenklecks hatte sich das römische Imperium im Laufe der Jahrhunderte auf der politischen Landkarte ausgebreitet: vom Atlantik im Westen bis zum Schwarzen Meer und Vorderen Orient im Osten, von Großbritannien im Norden bis nach Nordafrika im Süden. Überall dort, wo nicht Wasser oder Wüste das Territorium markierten, wurden künstliche Grenzen geschaffen – in Form von Palisaden, Mauern, Wällen und Gräben.
Im Südwesten Deutschlands, wo Rhein und Donau dem Land Luft lassen, wurde um die Mitte des 2. Jahrhunderts der Verlauf der Provinzen Obergermanien und Rätien abgesteckt: von Rheinbrohl im Westen durch den Westerwald und das Taunus-Gebirge bis nach Lich-Arnsburg, von dort Richtung Süden bis nach Lorch, anschließend – Knick nach Osten – in einem Bogen um das Nördlinger Ries bis nach Kelheim nahe Regensburg (siehe Karte auf der nächsten Seite): alles in allem genau 550 Kilometer Grenzbefestigung, gesäumt von rund 900 Wachtürmen und etwa 120 Kastellen. Niedergeschrumpft auf den Maßstab 1 zu 10 000 ergäbe das ein imposantes, über 50 Meter langes Kartenwerk.
Eine solch detailgenaue Nachzeichnung liegt – freilich gestapelt – bei der Geschäftsstelle der Deutschen Limeskommission in Esslingen. Sechs Jahre hat der Archäologe Andreas Thiel zusammen mit dem Landesvermessungsamt in Stuttgart und Kollegen aus den anderen Limes-Bundesländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz daran gearbeitet. Keine leichte Aufgabe, denn vom Limes ist – zumindest oberirdisch – nur wenig erhalten geblieben. Luftbilder und geophysikalische Messungen halfen bei den Untersuchungen (siehe Kasten rechts „Ohne Spachtel und Spaten“), doch meist war – im wahrsten Sinne des Wortes – Wandeln auf den Spuren der Römer angesagt: Zu Fuß wurde die Grenzanlage erkundet und ihr Verlauf vor Ort minutiös festgehalten. „Die Bestandsaufnahme war notwendig, um den Titel Weltkulturerbe zu beantragen“, sagt Thiel, der mit seinem Mammut-Projekt in die Fußstapfen der Reichs-Limeskommission tritt. Sie hatte den obergermanisch-rätischen Grenzstreifen bereits Ende des 19. Jahrhunderts in einem ersten Anlauf kartiert – doch in der alten Darstellung gab es Lücken und Fehler. Zwar konnten nicht alle beseitigt werden, doch durch die neue Vermessung wurde der Verlauf des Limes um bis zu 20 Meter korrigiert.
Obwohl die Maße mittlerweile genommen sind, bleibt unklar, wie die Anlage genau Gestalt gewonnen hat. Man kennt zwar die einzelnen Bauschritte, nicht aber den exakten Zeitplan. Im 1. Jahrhundert wurde eine Schneise durch die Wälder geschlagen, um die Grenze zu den Germanen zu markieren. Hölzerne Wachtürme säumten den Weg. Nach neuesten Erkenntnissen wurde der Kontrollstreifen außerdem durch einen sperrigen Holzzaun verstärkt. Alle anderthalb Meter rammten die Römer Pfosten in den Boden und schlossen die Zwischenräume mit Flechtwerk oder dünnen Baumstämmen. Wesentlich robuster war der bis zu drei Meter hohe, geschlossene Palisadenzaun aus gespaltenen Eichenstämmen, die Kaiser Hadrian um das Jahr 120 errichten ließ.
Sein Nachfolger Antoninus Pius wagte sich 40 Jahre später weiter in germanische Gefilde vor und verlegte den Limes – samt Schneise und Palisaden – Richtung Osten und Norden. „In den kommenden fünf Jahrzehnten wird die neue Grenze in Obergermanien mit einem zwei Meter tiefen und sechs bis acht Meter breiten Spitzgraben und einem entsprechend hohen Wall verstärkt. In Rätien – dem Gebiet östlich des heutigen Rotenbachtals in der Nähe von Schwäbisch Gmünd –, wo es viel Kalkstein gibt, wird daraus eine etwa 2,5 bis 3 Meter hohe, 1,2 Meter starke und 167 Kilometer lange Mauer errichtet. Die Holztürme werden überall durch Steintürme ersetzt“, erklärt Experte Thiel. „Wir wissen allerdings nicht, wann genau der Ausbau stattgefunden hat“, räumt er ein. Die Datierung von Hölzern, die im feuchten Untergrund der rätischen Mauer – im Volksmund „Teufelsmauer“ genannt (siehe Kasten rechts „Das Teufelswerk“) – liegen, sollen in den nächsten fünf Jahren Gewissheit bringen. Entsprechende Untersuchungen an den Palisaden haben ergeben, dass der älteste Teil des hölzernen Vorhangs um das Jahr 120 errichtet, anschließend aber nie repariert worden ist. „Viele Kollegen gehen mittlerweile davon aus, dass die Palisaden generell nach etwa 30 Jahren morsch und marode waren, aufgegeben wurden und durch Graben und Wall beziehungsweise die Steinmauer ersetzt worden sind“, sagt Thiel. Damit wäre die bisherige Lehrmeinung vom Tisch, wonach Palisaden, Graben und Wall jahrzehntelang nebeneinander bestanden haben.
Diese Erkenntnis rüttelt nicht nur an der Formation, sondern auch an der Funktion des Limes. Eine hermetisch geschlossene Grenze konnte er in dieser neuen – abgespeckten – Version nicht gewesen sein. Zumindest in Obergermanien waren Graben und Wall für Fußgänger und Reiter kein ernst zu nehmendes Hindernis. Einzelne illegale Einwanderer, die vom Ruhm des Römischen Reiches mit seinen zahlreichen Straßen, seinen beheizten Bädern, seinen prächtigen Steinbauten, seinem überaus ausgeklügelten Abwassersystem und seiner hervorragenden Verwaltung angelockt wurden, hatten bei Nacht und Nebel gute Chancen, unbemerkt zu bleiben. Unmöglich war es allerdings, Waren auf Wagen über die Grenze zu bugsieren. „Der Limes war kein unüberwindliches Bollwerk. Vielleicht sollte er einfach nur Schmuggel verhindern“, vermutet Thiel. Wer Fell, Leder, Honig und Bernstein nach Süden oder Werkzeuge, Stoffe, Glas und Silberschmuck nach Norden transportieren wollte, musste einen der offiziellen Grenzübergänge passieren – und vermutlich Zoll zahlen.
Der Limes trennte die Armen und Reichen der Antike, die Schriftgelehrten von den Namenlosen. Vor allem aber sollte er potenziellen Feinden die Macht des Römischen Reiches vor Augen führen. Besonders beeindruckt dürften die Germanen vom Limesabschnitt zwischen Walldürn und dem Haghof bei Welzheim gewesen sein. Dort verlief die Grenze 81 Kilometer schnurgerade von Norden nach Süden – Tälern, Bergen und Flüssen zum Trotz. Es scheint, als wollten die Römer beweisen, dass selbst die Natur ihrer Macht nicht im Wege stehen konnte.
Géza Alföldy, emeritierter Professor für Alte Geschichte an der Universität Heidelberg, glaubt zu wissen, wessen Handschrift der Propaganda-Bau trägt. Der römische Senator Gaius Popilius Carus Pedo war ungefähr von 152 bis 155 n.Chr. Statthalter der Provinz Obergermanien. Nicht nur zeitlich passt er ins Bild des imposanten Projekts: Pedo hatte sich bereits in Rom als Curator der öffentlichen Bauten einen Namen gemacht. Außerdem war er verantwortlich für die Instandhaltung der Via Aurelia, die sich – streckenweise schnurgerade – an der italienischen Westküste entlangzog. „Pedo liebte anscheinend lineare Konstruktionen“, sagt Historiker Alföldy. Vielleicht hat Kaiser Antoninus Pius den römischen Aristokraten gerade deshalb zu seinem Stellvertreter in Obergermanien ernannt – wohl wissend, dass dessen militärische Ambitionen minimal und seine strategischen Kenntnisse gleich Null waren. Vielmehr agierte er gemäß dem Motto des griechischen Schriftstellers Themistios, wonach das Römische Reich nicht nur durch Flüsse und Wälle zu schützen sei, sondern auch durch die Angst der Feinde.
Noch heute lässt Pedos Werk Ingenieure staunen. Wie die über 80 Kilometer lange Strecke ohne Landkarten und moderne Hilfsmittel wie das Satellitennavigationssystem GPS so präzise abgesteckt werden konnte, ist nach wie vor ein Rätsel.
Auch wenn der Limes kein unüberwindliches Bollwerk war, an militärischem Geschütz mangelte es nicht. Um das Jahr 200 waren zwischen Rhein und Donau an die 60 Einheiten von Hilfstruppen stationiert, ein Heer von insgesamt 35 000 Berufssoldaten – Fußtruppen ebenso wie Reitereinheiten. Ein kostspieliger Aufmarsch, der jährlich rund 80 Millionen Sesterzen aus der römischen Staatskasse riss.
Dass alle Hilfstruppen allein für die Grenzsicherung zuständig waren, halten Forscher eher für unwahrscheinlich. Wozu sollte man 4500 hervorragend ausgerüstete Reiter – damalige Spitzenverdiener – für den kleinräumigen Kontrolldienst abstellen? Viel eher waren sie für schnelle Eingriffe und weit reichende Patrouillen prädestiniert. „Sie hatten sicher eher überregionale Aufgaben und mussten auch für den Einsatz in anderen Reichsteilen gerüstet sein“, vermutet Martin Kemkes, wissenschaftlicher Leiter des Limesmuseums in Aalen. „Für Bauarbeiten und Besorgungen waren hingegen wohl alle Soldaten am Limes zuständig.“ (Details finden Sie im Kasten „Im Dienste Roms“.)
Rund 900 Wachtürme waren entlang des Limes im Abstand von 400 bis 800 Metern aneinander gereiht. Heute ragen die Reste – wenn überhaupt – als steinerne Stümpfe aus dem Boden. Ursprünglich waren die Kontrollposten zwischen sieben und neun Meter hoch und wahrscheinlich mit einer umlaufenden Galerie versehen. „Die Wachtürme waren wohl nicht immer besetzt. Es gab dort keine Heizung und im Winter hat wahrscheinlich ohnehin der Schnee die Germanen gebremst“, sagt Archäologe Kemkes. „Grenzpatrouillen waren aber natürlich ständig unterwegs. Und die Römer hatten sicherlich Spione in Germanien, die sie warnten, wenn Gefahr im Verzug war.“
Trotz aller Vorsicht konnten Übergriffe von germanischen Plünderern, die den Limes überquerten und römische Siedlungen heimsuchten, oft nicht verhindert werden. Doch ungeschoren kamen sie nicht davon. Durch Rauchzeichen oder Boten alarmiert, versuchten die Grenzpatrouillen, die Eindringlinge einzuholen oder auf ihrem Rückweg vor dem Limes abzufangen. Damit war der Rachedurst der Römer noch nicht gestillt. Während die Diebe dingfest gemacht wurden, brachen die Soldaten der benachbarten Kastelle zu einer Strafexpedition in germanisches Gebiet auf und brannten nach dem Prinzip „Auge um Auge“ die Siedlungen der Missetäter nieder.
30 Asses bekam ein Reitersoldat zu Beginn des 3. Jahrhunderts täglich für seine Dienste, abzüglich der Kosten für Kleidung, Verpflegung und Tierfutter. Zum Vergleich: Für eine dieser Münzen (ein Aes) gab es ein halbes Kilogramm Getreide oder einen halben Liter Wein. An Festtagen – zwischen Januar und September wurde 27-mal allein dem Kaiser gehuldigt – erhielten die Soldaten Sonderzuschläge. „Für sein Pferd musste jeder Reiter eine Kaution von 125 Denaren hinterlegen“, weiß Römerkenner Kemkes. So war sicher gestellt, dass der Gaul gut behandelt wurde. Auch in anderer Hinsicht bewiesen die Römer Weitblick. Der Sold wurde nicht gänzlich in bar ausgezahlt, sondern teilweise, als Altersvorsorge, auf einem Sparbuch angelegt – Listen, die in der Registratur einer Einheit geführt wurden. Auch deshalb sind römische Münzen heute im Fundus der Archäologen äußerst rar.
Im Welzheimer Alen-Kastell macht nicht nur die Rentenpolitik der Römer den Wissenschaftlern zu schaffen: Ein Raubgräber hat mit einem Metalldetektor die freigelegte Fläche abgesucht und – wohl fündig geworden – wühlmausartige Löcher gegraben. „ Mittlerweile haben wir den Dieb dingfest gemacht“, sagt Rüdiger Krause sichtlich triumphierend.
Die Geschichte des Limes kann jetzt ohne Lücken weitergeschrieben werden. „Alles deutet darauf hin, dass das Kastell zerstört worden ist, dann aber wieder überbaut und als Zivilsiedlung genutzt wurde“, erklärt Krause. Wahrscheinlich handelte es sich bei den neuen Bewohnern um einen Teil jener Germanen, die in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts von der Elbe unaufhaltsam Richtung Süden zogen. Die Römer konnten den Eindringlingen wenig entgegensetzen – das Imperium wurde von wirtschaftlichen Problemen und inneren Unruhen gebeutelt.
Den viel zitierten Alamannensturm – eine Großoffensive, mit der der Limes im Jahr 260 überrannt worden sein soll – hat es nach neuesten Erkenntnissen nicht gegeben. Da Rom taumelte, brachten die einfallenden Germanen die Grenze, die im engeren Sinn nie eine gewesen war, nach und nach zu Fall. ■
Bettina Gartner
Ohne Titel
Draufgänger waren fehl am Platz. Denn mit Abenteuer hatte die Arbeit am Limes wenig zu tun. Die meiste Zeit ging es ruhig zu an der Grenze zwischen Römischem Reich und germanischem Gebiet. Barbaren, also jene, die „Bar-Bar“ – „unverständlich“ – redeten, ließen sich nur selten blicken. Dichte Wälder und bis zu eine Tagesreise lagen teilweise zwischen dem Limes und den Siedlungen der Germanen. Die römischen Grenzsoldaten konnten fast immer unbehelligt ihren Dienst tun. Mit geschlossenem Helm, das Langschwert geschultert, den Dolch stets griffbereit, hielten sie Wache. Im Sommer trugen sie eine leichte Tunika, im Winter warfen sie ein rechteckiges Wolltuch – das „sagum“ – um. Hosen galten als barbarische Unsitte und wurden anfangs – wenn überhaupt – nur von den Reitern getragen. Möglicherweise brachte das raue Klima im römischen Norden die Soldaten aber bald zur Räson.
Als Schuhwerk dienten im 1. Jahrhundert vor allem sandalenartige Stiefel mit benagelten Sohlen, die „caligae“. Im 2. Jahrhundert wurden sie durch geschlossene Schuhe ersetzt. Daneben gab es Holzpantinen für die Thermen und Sandalen mit Ledersohle und Zehenriemen für zu Hause – „eine Art primitive Birkenstock“, schmunzelt Alexander Zimmermann von der Interessengemeinschaft für Experimentelle Archäologie in Pliezhausen.
Die am Limes stationierten Soldaten stammten aus verschiedenen Regionen des Römischen Reiches: Räter aus dem Alpenraum waren genauso darunter wie Kelten aus Gallien und Thraker aus dem heutigen Bulgarien. Sie alle waren Fremde im Dienste Roms: Als Mitglieder der Hilfstruppen besaßen sie kein römisches Bürgerrecht. Erst nach 25 Dienstjahren wurde ihnen dieses Privileg zuteil – das unter anderem Rechtssicherheit und Steuererleichterung versprach.
Die Männer, die in der Regel mit 17 bis 20 Jahren in die Armee eintraten, kamen meist nicht allein an die obergermanisch-rätische Grenze. Frauen und Kinder fanden in den kastellnahen Lagerdörfern – den Kastellvici – ein neues Zuhause, offiziell aber hatten die Soldaten Heiratsverbot.
Wann die Soldaten morgens ihren Dienst antraten, ob sie in Schichten arbei- teten oder nachts nur eine Notbesatzung bereit stand, ist nicht bekannt. Die Soldaten mussten Wache stehen, patrouillieren, exerzieren und ihr Können für den Ernstfall unter Beweis stellen. Sie mussten die Kasernen reinigen, am Kastell werkeln sowie Holz und frisches Wasser herbei schleppen – wobei sie sich nicht selten in den germanischen Wäldern bedienten. Getreide und Fleisch, Obst und Gemüse wurden von den großen Gutshöfen – den „villae rusticae“ – geliefert, die sich meist nur wenige Kilometer voneinander entfernt in den Provinzen drängten.
Wer sich nach getaner Pflicht ein Glas Wein aus Gallien gönnen wollte oder für seine Liebste ein extravagantes Schmuckstück suchte, kehrte im Kastelldorf ein. Dort gab es Gasthäuser und Geschäfte, Handwerksbetriebe und Schaubuden.
Eine Besonderheit war das römische Bad, das die Solda- ten meist täglich besuchten. Fußbodenheizung und Massagen, Wechselbäder und Körperpeeling sorgten für Sinnesfreuden und Sauberkeit. Wer nicht nur körperlichen Genüssen, sondern auch den Göttern huldigen wollte, tat dies vor dem Fahnenheiligtum, dem zentralen Raum des Stabsgebäudes, das im Zentrum eines jeden Kastells lag. Auch der Kaiser – präsent in Form von Porträts – oder die Feldzeichen, zum Beispiel die Abteilungsfahne, wurden dort verehrt.
Untergebracht waren die Männer des Militärs in Kasernen. Jede Kaserne bestand aus zehn Stuben. Jede Stube war wiederum in zwei Räume unterteilt. Im vorderen Bereich wurden Waffen und Ausrüstungen aufbewahrt, im hinteren Teil – etwa 20 bis 25 Quadratmeter groß – gab es Betten, Tische, Stühle und eine offene Herdstelle. Wahrscheinlich teilten sich acht Fußsoldaten eine Unterkunft. Bei den Reitereinheiten war die Raumaufteilung ähnlich. Allerdings wohnten dort nur drei Soldaten zusammen, und im Vorraum waren statt der Geräte die Pferde untergebracht, wie Jauche-Rinnen beweisen. Die Soldaten selbst mussten ihre Bedürfnisse in Gemeinschaftslatrinen nahe der Kastellmauer verrichten. Die Offiziere logierten viel luxuriöser, auf etwa 100 Quadratmetern und mit eigener Toilette.
COMMUNITY LESEN
Dietwulf Baatz
Der Römische Limes
Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau
Gebr. Mann Verlag 2000
€ 20,90
Martin Kemkes u.a.
Am Rande des Imperiums
Der Limes – Grenze Roms zu den Barbaren
Jan Thorbecke Verlag 2002, € 18,–
INTERNET
Informationen rund um Aktivitäten und Auftritte der Römertruppe von Alexander Zimmermann finden Sie unter:
www.legio8augusta.de
Die Deutsche Limeskommission kümmert sich um den Schutz, die Erforschung und die Präsentation des Weltkulturerbes:
www.deutsche-limeskommission.de
Eine Streckenübersicht über die römischen Sehenswürdigkeiten und Museen an der Deutschen Limesstraße finden Sie unter:
www.limesstrasse.de
TIPP
Landesausstellung Baden-Württemberg 2005:
• Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau
Kunstgebäude Stuttgart
vom 1. Oktober 2005 bis 8. Januar 2006
• Imperium Romanum. Römer, Christen, Alamannen – die Spätantike am Oberrhein
Karlsruher Schloss
vom 22. Oktober 2005 bis 26. Februar 2006
Informationen zu beiden Ausstellungen finden Sie unter:
www.imperium-romanum-2005.de
MUSEEN
Limesmuseum Aalen
St.-Johann-Straße 5
73430 Aalen
Eintritt: € 3,20
www.limesmuseum.de
Römermuseum
Martin-Luther-Platz 3
91781 Weißenburg in Bayern
Eintritt: € 2,–
www.weissenburg.de
Römerkastell Saalburg
Archäologischer Park
61350 Bad Homburg vor der Höhe
Eintritt: € 3,–
www.saalburgmuseum.de
Ohne Titel
Die Totenruhe ist gesichert. Um Gräber und Mauern zu erkunden, die der Boden im Laufe der Jahrhunderte dem Bick entzogen hat, müssen Wissenschaftler längst nicht mehr zum Spaten greifen, sondern können mit modernstem Gerät in die Erde schauen. Im bayerischen Ruffenhofen haben Geophysiker des Landesamtes für Denkmalpflege auf diese Weise – also rein virtuell – ein Limes-Kastell freigelegt.
Dass unter dem mehr als 40 Hektar großen Acker Reste römischer Vergangenheit ruhen, war schon lange bekannt. Bereits 1892 führte die Reichs-Limeskommission, die den obergermanisch-rätischen Grenzwall erstmals systematisch untersuchte, Probegrabungen durch. Dabei kamen das Stabsgebäude, ein Speicherbau und ein Kastellgraben zum Vorschein. Heute weiß man: Nicht nur ein einziger Graben, sondern gleich vier umgrenzten das etwa drei Hektar große Lager, fünf Kasernen boten Platz für 300 Soldaten, neben dem Stabsgebäude lag das Wohnhaus des Kommandanten und außerhalb der Kastellmauern ein Dorf. Mit Hilfe elektrischer und magnetischer Messungen haben die Wissenschaftler Helmut Becker und Jörg Faßbinder die Strukturen sichtbar gemacht.
Bei der Geoelektrik wird der Boden unter Strom gesetzt – denn je nach Beschaffenheit der Erde wird der Strom mehr oder weniger gut geleitet. Trockenes Mauerwerk erhöht den elektrischen Widerstand, eine feuchte Grube senkt ihn. Diese Schwankungen werden registriert und auf dem Computer aufgezeichnet. Dabei werden die Signale in ein Schwarz-Weiß-Muster verwandelt, auf dem die Stellen mit hohem Widerstand als dunkle Flecken, jene mit geringem Widerstand als helle Flächen erscheinen. „Jeder Stoff hat einen bestimmten elektrischen Widerstand“, erklärt Geophysiker Faßbinder. „Dennoch bedarf es viel Erfahrung, um zu erkennen, ob es sich bei den entdeckten Strukturen um einen Töpferofen, eine Kaserne oder ein Gräberfeld handelt. Und: Geophysikalische Daten liefern zwar Informationen darüber, was im Boden liegt, nicht aber, wie alt die Reste sind. Das muss der Archäologe anhand typischer Bauformen und von Keramikfunden erkennen.“
Ähnlich schwierig ist die Deutung geomagnetischer Messungen. Mit Hilfe eines Magnetometers wird dabei knapp über dem Boden das natürliche Erdmagnetfeld aufgezeichnet. Seine Intensität kann durch Unregelmäßigkeiten im Untergrund beeinträchtigt werden. Durch einen Brand etwa verwandeln sich Eisenoxide in der Erde in stark magnetische Mineralien wie Maghemit und Magnetit. Sie zeigen den Forschern, dass ein antiker Ofen oder eine Feuerstelle im Boden liegt. Mauern aus Kalkstein dagegen erzeugen nur ein schwaches Signal. Selbst Störungen, die fünf Millionen Mal schwächer sind als das Erdmagnetfeld, können noch registriert werden.
Das Erstaunliche: Auch Gruben und Pfostenlöcher, die mit organischem Material verfüllt und eigentlich unmagne- tisch sind, lassen sich orten. Den Grund dafür hat Jörg Faßbinder herausgefunden: „In solchen Speichergruben sammeln sich viele Bakterien an, weil es dort reichlich zu fressen gibt. Sie nehmen aus dem Boden gelöste Eisenoxide auf, bilden daraus Magnetite und speichern sie in ihrem Körper. Dadurch werden die Bakterien zu lebenden Kompassnadeln, die sich im Sediment ausrichten. So finden sie – im Gegensatz zu ihren unmagnetischen Artgenossen – auf kürzestem Weg zu ihrer Nahrungsquelle. Und uns weisen sie noch Jahrtausende nach ihrem Tod den Weg zu archäologischen Funden.“
Ohne Titel
Limes, lernt der Lateiner, bedeutet so viel wie Grenzweg oder Schneise. Heute sind damit normalerweise die Grenzen des Römischen Reiches gemeint, die nicht von Meer und Flüssen umspült wurden. In Obergermanien und Rätien wurden sie durch Palisaden, Graben und Wall beziehungsweise eine Mauer markiert, im Norden Britanniens durch den steinernen Hadrianswall, in Kappadokien und Syrien durch eine Militärstraße. In Dakien, dem heutigen Rumänien, zogen sich Wall und Graben durch die Erde, in Tunesien und Algerien durch den Wüstensand. Selbst das militärische Aufgebot an Kastellen und Wachtürmen entlang der Donau – in Österreich, Ungarn, der Slowakei und Kroatien – wird Limes genannt, obwohl dort der Fluss ein natürliches Hindernis bildete.
Ursprünglich stammt der Begriff Limes aus dem Rechtswesen und bezeichnete die Grenze von Grundstücken. An Wachtürme und Kastelle, Wälle und Gräben dachte dabei niemand – der militärische Sinn kam erst später hinzu.
Wie aber nannten die Zeitgenossen das Befestigungswerk in den römischen Provinzen Obergermanien und Rätien? Die Wissenschaftler rätseln.
Die Menschen im Mittelalter konnten es kaum glauben, dass ein solch imposanter Bau von ihresgleichen geschaffen worden war. Der Satan höchstpersönlich sei am Werk gewesen. Als Christus auf der Erde weilte, habe er mit dem Gottessohn einen Pakt geschlossen: Um die jeweiligen Herrschaftsgebiete klar voneinander abzugrenzen, sollte der Teufel sein Reich bis zum nächsten Morgen mit einer Mauer umgeben. Eifrig machte sich der Höllenfürst ans Werk, riss aus den Bergen zentnerschwere Felsstücke herab und türmte sie übereinander. Mit seinem glühenden Schweif brannte er eine tiefe Furche in die Erde. Doch zu gierig war der Satan zugange, vergaß die Zeit, und als der Hahn krähte und ihn fortjagte, hatte er sein Werk nicht einmal zur Hälfte vollendet. Trotzdem blieb ein Stück der „Teufelsmauer“ als sichtbares Andenken seines Treibens zurück.
Eine zweite Bezeichnung für die Grenzanlage in Obergermanien und Rätien taucht in Urkunden aus dem 8. Jahrhundert auf. Dort ist oft von phâl – Pfahl – die Rede. Der Begriff geht auf das lateinische Wort „palus“ zurück und benennt ein zugespitztes, in den Boden gerammtes Bauholz. Vielleicht, so vermuten die Wissenschaftler, wurden damit in der Antike die Palisaden bezeichnet, die lange vor Graben, Wall und Mauer die römische Reichsgrenze zum Germanengebiet markierten. Für Andreas Thiel, Archäologe am Baden-Württembergischen Landesdenkmalamt in Esslingen, steht fest: „Wenn ich mich bei einem Römer nach dem Limes erkundigen wollte, würde ich nach dem palus fragen.“
„Habemus Hereditatem“
bild der wissenschaft: Der obergermanisch-rätische Limes ist jetzt Teil des Weltkulturerbes. Was hat er davon?
ULRICH PFEIFLE: Die Reste der römischen Grenzanlage werden stärker geschützt. Die Unesco selbst gibt diesbezüglich zwar keine Regeln vor, doch sie wacht darüber, dass die nationalen Gesetze zum Denkmalschutz strikt eingehalten werden. Rekonstruktionen etwa müssen möglichst authentisch sein und bestimmten Standards folgen – nicht, dass zum Schluss eine Art römische Würstelbude am Limes steht. Wenn jemand in der Nähe der Grenzanlage etwas bauen will, muss er gebührenden Abstand halten. Was passiert, wenn gegen die allgemeinen Vorschriften verstoßen wird, sieht man am Beispiel des Kölner Doms, der auch zum Weltkulturerbe zählt. Weil geplante Neubauten die Sicht auf ihn zu versperren drohen, hat die Unesco ihn auf die Rote Liste gesetzt. Das ist eine Verwarnung – schlimmstenfalls kann der Titel „Weltkulturerbe“ auch aberkannt werden.
bdw: Das Gütesiegel schafft Verpflichtungen, bringt aber gleichzeitig viele Vorteile. Stellt die Unesco Gelder für den Schutz zur Verfügung?
PFEIFLE: Nein, von der Unesco selbst gibt es in der Regel keine finanzielle Unterstützung. Aber die Länder und Kommunen erklären sich jetzt natürlich viel eher bereit, Gelder für die Erhaltung, Erforschung und touristische Nutzung locker zu machen. In Aalen beispielsweise wird das Limesmuseum derzeit für 1,5 Millionen Euro erweitert – eine Million stellt das Land Baden-Württemberg zur Verfügung, eine halbe Million die Stadt Aalen. Und die Auszeichnung lockt natürlich viele Touristen an.
bdw: Weltweit gehören mittlerweile 812 Stätten zum Welterbe, in Deutschland sind es jetzt 31. Welche Kriterien müssen erfüllt werden, um in die illustre Liste aufgenommen zu werden?
PFEIFLE: Das Objekt muss von herausragendem kulturellem Wert sein – und zwar für die ganze Menschheit. Außerdem muss es historisch echt sein. Für den Limes bedeutet dies: Die meisten Rekonstruktionen – beispielsweise das Numerus-Kastell in Welzheim – zählen streng genommen nicht zum Weltkulturerbe. Für die Antragstellung mussten auch der aktuelle Erhaltungszustand des Limes detailliert beschrieben und ein Plan für den künftigen Schutz vorgelegt werden.
bdw: War die Entscheidung der Unesco bezüglich des obergermanisch-rätischen Limes eindeutig?
PFEIFLE: Ja, schon bald war klar: Habemus Hereditatem – wir haben das Erbe. Trotzdem haben wir vor der Entscheidung gezittert. Denn der Titel ist heiß begehrt und die Unesco versucht jetzt verstärkt, auch afrikanische und asiatische Bewerber zu berücksichtigen. Im Falle des Limes wurde eine salomonische Lösung gefunden: Er ist zusammen mit dem Hadrianswall, der bereits seit 1987 zum Weltkulturerbe gehört, in einem Projekt – den „Frontiers of the Roman Empire“ – zusammengefasst worden. Was die Kommission auch überzeugt hat, war die Tatsache, dass der Limes mehrere Bundesländer umfasst. Vielleicht – so das Ziel – steht eines Tages sogar die gesamte römische Reichsgrenze unter internationalem Schutz.
bdw: Welche Projekte und Forschungen rund um den obergermanisch-rätischen Limes sind in Zukunft geplant?
PFEIFLE: Die Archäologen wollen in den kommenden Jahren das Gebiet vor dem Limes, also auf der germanischen Seite, verstärkt untersuchen. Außerdem sollen an einigen Grenzübergängen Grabungen durchgeführt werden. Vielleicht gelingt es ja auch, eine zivile Siedlung – einen so genannten Kastellvicus – zu rekonstruieren. Und natürlich sollen Grundstücke, auf denen es Reste des Limes gibt, aufgekauft, stillgelegt und somit gesichert werden. Außerdem wollen wir versuchen, denkmalgerechten Tourismus zu betreiben. Möglichst viele Menschen sollen den Limes kennen lernen, ihn dabei aber nicht überrennen.
Das Gespräch führte Bettina Gartner ■
Ulrich Pfeifle (63) ist Gründer und Vorsitzender der Deutschen Limesstraße und Mitglied der Deutschen Limeskommission. 30 Jahre lang – bis zum 31. Juli 2005 – war er Oberbürgermeister von Aalen.