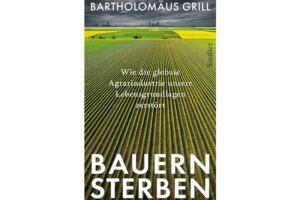Als Ingenieur könnte man vor Neid erblassen. Die Schürfwunde heilt von allein, selbst der gebrochene Knochen wächst wieder zusammen. Ärzte leisten dabei zwar Hilfestellung, aber letztlich sorgt der Körper selbst dafür, dass Haut und Knochen wieder in Ordnung kommen. Ganz anders in der Technik: ein Kratzer im Autolack, ein Sprung in der Scheibe oder ein Riss im Stahlträger – und schon sind mehr oder minder aufwendige Reparaturen nötig. Im Extremfall hilft nur noch, das defekte Teil auszutauschen.
Doch das soll nicht so bleiben. Seit über einem Jahrzehnt suchen Materialwissenschaftler nach Wegen, wie technische Gegenstände von allein heilen können. Einer dieser Wissenschaftler ist Blazej Grabowski vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE) in Düsseldorf. Zusammen mit seinem Kollegen Cem Tasan leitet er die Gruppe „Adaptive Strukturwerkstoffe“. Grabowski ist für die theoretische Seite der Forschung zuständig, Tasan für die Experimente.
„Wir wollen eine Legierung entwickeln, die sich selbst heilt, wenn sich in ihr Nanorisse bilden“, sagt Grabowski. Diese winzigen Nanorisse sind der Ursprung allen Übels: Unternimmt man nichts gegen sie, werden sie im Lauf der Zeit größer, bis der betroffene Gegenstand massiv in seiner Funktion beeinträchtigt ist – womöglich sogar bricht. „Nanorisse entstehen zum Beispiel, wenn ein Bauteil immer wieder an derselben Stelle belastet wird.“
Grabowski und Tasan arbeiten an einem Material, in dem diese Nanorisse automatisch geflickt werden, sobald sie auftreten. Dazu nutzen die beiden Forscher einen Vorgang aus, der im Prinzip seit Langem bei der Stahlherstellung etabliert ist: Je nach Temperatur des Stahls verändert sich die kristalline Struktur des Materials.
„Diesen Vorgang bezeichnet man als Phasenübergang, weil sich dabei die physikalischen Parameter und Eigenschaften der Legierung schlagartig verändern können“, erklärt Grabowski. „Man kann sich das so vorstellen, als ob sich die Atome im Kristallgitter kollektiv bewegen und dadurch den Kristall neu ordnen.“ Durch diesen Phasenübergang schließen sich Nanorisse, weil sich die Materialstruktur im Großen verändert. Bei der Stahlherstellung nutzt man das aus, um eine hohe Qualität zu erzielen.
Doch für ein selbstheilendes Material sind Temperaturen von mehreren Hundert Grad Celsius, wie sie für die Stahlherstellung erforderlich sind, uninteressant, weil der Phasenübergang dann eine Energiezufuhr von außen braucht. Daher verwenden die MPIE-Forscher als Energielieferant Nitinol, eine Formgedächtnislegierung aus den Metallen Nickel und Titan. Schon seit Jahren gibt es sogenannte Titanbrillen zu kaufen, die sich fast beliebig knautschen lassen, ohne dass sie brechen. Mehr noch: Die Gestelle nehmen wieder ihre ursprüngliche Form an, wenn man sie nicht mehr zusammendrückt. In Wahrheit bestehen diese Brillen aus Nitinol, nicht aus Titan – „Nickel“ ist im Zeitalter der Allergien aber wohl im Marketing verpönt.
Heilsame Nanoteilchen
Grabowski und Tasan nutzen für ihre selbstheilende Legierung Nitinol in Form von Nanopartikeln mit einem Durchmesser von weniger als 100 Millionstel Millimeter. Diese Nanopartikel betten sie in ein Trägermaterial wie Titan-Vanadium ein. Vanadium ist auch Bestandteil vieler Stähle. Bildet sich ein Nanoriss, sorgen die Nitinolpartikel im Titan-Vanadium für einen schlagartigen Phasenübergang, der die durch den Riss entstandene Spannung kompensiert. Das funktioniert, weil der Riss die Struktur des Titan-Vanadiums in seiner Umgebung verzerrt, und es für die Nanopartikel dann energetisch günstiger ist, sich umzuwandeln. Bei einer solchen Umwandlung verformen sich nicht nur die Nanopartikel, sondern auch deren direkte Umgebung im Titan-Vanadium. Die Folge: Der Riss schließt sich wieder.
„Jedes Nanopartikel kann nur einmal zum Schließen eines Risses beitragen“, sagt Grabowski. „Aber durch die große Zahl an Partikeln haben wir die Hoffnung, dass zumindest eine Zeit lang genügend an der erforderlichen Stelle im Material vorhanden sind.“ Es wäre also keine Selbstheilung auf immer und ewig, aber sie würde die Wartungszyklen verlängern.
„Um ein funktionierendes Materialsystem zu entwickeln, müssen wir die optimalen Parameter für die Nanopartikel und ihre Verteilung im Titan-Vanadium ermitteln“, sagt Grabowski. Dies geschieht in einem engen Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis: Grabowski und seine Mitarbeiter simulieren die Materialsysteme quantenmechanisch am Computer, Tasan und seine Mitarbeiter stellen dann die vielversprechenden Systeme her und messen deren Eigenschaften. „Unsere bisherigen Ergebnisse sind ermutigend“, freut sich der Wissenschaftler. Bis zum Sommer 2017 wollen er und seine Kollegen die Machbarkeit ihres Ansatzes nachgewiesen haben.
Füllmaterial strömt in den Riss
Insgesamt ist das 2014 gestartete Forschungsprojekt auf drei Jahre angelegt und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Selbstheilende Materialien“ gefördert. Dieses Programm begann 2011 und wurde 2014 um drei weitere Jahre verlängert. Koordinator ist Ulrich Schubert, Professor für organische und makromolekulare Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
„Die Forschung an selbstheilenden Materialien erfolgt inzwischen an ganz verschiedenen Materialklassen, darunter Metalle, Keramiken, Beton und Polymere“, sagt Schubert. „Die Grundidee ist dabei immer, dass ein Riss durch einen gerichteten Materialtransport zur betroffenen Stelle behoben wird. Idealerweise löst allein der Riss den Vorgang aus, sodass keine externen Stimuli erforderlich sind.“ Nach der Selbstheilung kommt das zuvor bewegliche Material wieder zur Ruhe und das Bauteil hat im besten Fall dieselben mechanischen Eigenschaften wie vor dem Schaden. „Das Ziel dieser Forschung ist eine echte Fehlertoleranz, also nicht nur eine Verbesserung der Materialeigenschaften, etwa der Kratzfestigkeit der Oberfläche.“
Die für die Heilung erforderliche Energiemenge hängt stark vom Material ab. In einem Metall zum Beispiel sind die Atome in einem Kristallgitter angeordnet und lassen sich nicht so leicht verschieben. Das erschwert den maßgeschneiderten Massetransport. Polymere dagegen sind sehr große Moleküle, deren Struktureinheiten sich vielfach wiederholen – da haben die Forscher deutlich mehr Spielraum, zumal die erforderlichen Energiemengen bei vielen Polymeren recht gering sind.
Will man eine Selbstheilung bei einem Metall über die Temperatur auslösen, sind mehrere Hundert Grad Celsius erforderlich. Bei Polymeren dagegen genügen Temperaturen unter 120 Grad Celsius. Dies erklärt, warum den Polymeren bei den selbstheilenden Materialien derzeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als den Metallen. Selbstheilende Materialien auf Polymerbasis dürften in einigen Jahren die ersten kommerziellen Anwendungen ermöglichen. Solche Materialien sind zum Beispiel für Möbelhersteller interessant, um kleine Kratzer in den beliebten Hochglanzdekoren verschwinden zu lassen. Auch Kunststoffflächen in der Innenausstattung von Autos und Flugzeugen könnten dank selbstheilender Polymersysteme länger wie neu aussehen.
Wie die Selbstheilung mit Polymeren gelingen kann, hat eine Arbeitsgruppe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) zusammen mit Forschern am Leibniz- Institut für Polymerforschung in Dresden, der Australian National University in Canberra und des deutschen Chemieunternehmens Evonik in Essen erforscht. Die Projektbeteiligten haben bestimmte chemische Reaktionen untersucht, die sich durch eine relativ geringe Erwärmung und ohne weitere Stoffe wieder umkehren lassen.
Polymere an der Perlenschnur
„Solche Reaktionen sind in einem von uns experimentell untersuchten Polymernetzwerk möglich“, sagt Kim Öhlenschläger, Chemiker am KIT in der Arbeitsgruppe von Christopher Barner-Kowollik und maßgeblich an der Forschung beteiligt. In einem solchen Netzwerk – einem Festkörper – bilden die Polymere lange Perlenketten, die an manchen Stellen chemisch miteinander verknüpft sind. Ein Kratzer zerstört solche Verknüpfungen. „Wenn wir das Polymernetzwerk aber für wenige Minuten auf 70 bis 120 Grad Celsius erwärmen, bilden sich die Verknüpfungen erneut“, sagt Öhlenschläger.
Standardisierte mechanische Tests zeigen, dass das Material nach der Selbstheilung wieder seine ursprünglichen Eigenschaften besitzt. „Diese Selbstheilung funktioniert auch mehrmals nacheinander“, betont der Chemiker. „Um einen Kratzer in einem solchen Lack zu beseitigen, müsste man nicht extra zur Werkstatt fahren. Ein Heizstrahler aus dem Baumarkt würde genügen. Erwärmt man damit die beschädigte Stelle, verschwindet der Kratzer.“
Erste Berechnungen besagen, dass das funktionieren könnte, solange der Kratzer nicht tiefer als die halbe Lackdicke ist. Die heutige Vision selbstheilender Materialien ist also weit entfernt von Filmen wie „Terminator 2″, in dem der böse Androide T-1000 Schussverletzungen in seinem Körper mit einer sogenannten mimetischen Polylegierung innerhalb von Sekunden ausheilen kann.
„Unser Ziel ist es, kleine Schäden in Bauteilen zu beseitigen, bevor sie sich zu kritischen Schäden auswachsen“, sagt der Jenaer Chemiker Ulrich Schubert. „Doch vieles, was heute im Labor funktioniert, klappt im Alltag noch nicht, weil wir dort die Umgebungsbedingungen nicht so gut kontrollieren können.“ Man darf gespannt sein, für welche Überraschungen die neuen Wunderheiler-Materialien sorgen werden. •
von Michael Vogel
Kompakt
· Mit Rissen in den Wänden und Kratzern auf Lacken könnte es bald vorbei sein.
· Forscher versuchen, Metalle, Keramiken, Polymere und sogar Beton gegen Schäden resistent zu machen – im Idealfall ohne äußere Hilfe.
· Beschichtungen werden voraussichtlich die erste Anwendung sein.
Ohne Titel
MICHAEL VOGEL berichtet in bild der wissenschaft regelmäßig über neue technische Entwicklungen.
Lesen
Überblicksbeiträge zum Thema selbstheilende Materialien:
Sybrand van der Zwaag Self Healing Materials Springer, Heidelberg 2007, € 224,25
Martin Hager u.a. Self-Healing Materials Advanced Materials, Bd. 22 (2010), S. 5424–5430 www.schubert-group.de/index.php?option= com_jresearch&controller=publications&task= show&id=506Itemid%3D55&Itemid=55
Internet
DFG-Schwerpunktprogramm „Design und allgemeine Prinzipien selbstheilender Materialien“: www.spp1568.uni-jena.de
Film über die Eigenschaften von Formgedächtnislegierungen: www.youtube.com/watch?v=QYp9rIJRM8s.