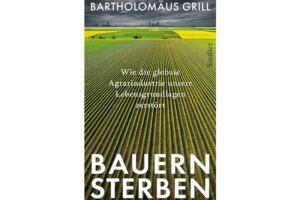Auch Wissenschaftler scheuen nicht immer vor knackigen Schlagzeilen zurück. Der Psychologe Paul Bloom von der renommierten Yale University zeigt gerade, wie es geht: „Against Empathy“ heißt sein neues Buch, und er warnt darin tatsächlich vor zu viel Mitgefühl. Meint er das ernst?, fragt man sich unwillkürlich, und dieser Effekt ist natürlich kalkuliert. Ja, er meint es ernst. Zu viel Mitgefühl könne Ausgrenzung und Diskriminierung befördern, als Gegenmittel empfiehlt er eine rationalere, distanziertere Perspektive auf andere Menschen. In einem Artikel in der „Washington Post“ und einem kurzen Video des „Atlantic“ fasst Paul Bloom seine Argumente zusammen: Unser Mitgefühl sei kein guter Wegweiser in moralischen Belangen, es mache uns nicht zu besseren Menschen.
Empathie ist zum einen ungerecht, schreibt Bloom. Das Schicksal eines kranken Kindes kann uns zum Beispiel so sehr bewegen, dass wir Geld an Hilfsorganisationen spenden, während uns das Schicksal anderer, ähnlich hilfsbedürftiger Menschen kalt lässt. Oft genug fühlt man mit den Menschen mit, die einem ähnlich sind oder nahestehen. Wie es den Menschen im 22. Jahrhundert mit dem Klimawandel gehen wird, spielt in den aktuellen Debatten zum Beispiel keine Rolle. Mehr noch: Das Mitgefühl mit einer Person geht oft mit Feindseligkeit gegenüber anderen einher. Bloom zitiert eine Studie, in der Probanden mit einem Studenten in einem Wettbewerb mitfieberten und seinen Konkurrenten Unglück wünschten, obwohl diese nichts Böses getan hatten. Und nicht zuletzt sollten wir politische Entscheidungen zum gesellschaftlichen Zusammenleben auf solide Statistiken stützen statt auf das Mitfühlen mit einzelnen Personen, argumentiert Bloom.
Helfen aus Einsicht, nicht aus Mitgefühl
Ein naheliegendes Beispiel für die US-amerikanische Debatte sind die Waffengesetze: Man kann das Leiden eines unschuldigen Opfers darstellen, um Stimmung zu machen, oder das Sicherheitsbedürfnis einer bedrohten Person. Aber sinnvoller wäre es nach Blooms Ansicht zu untersuchen, wie viele Menschen bei einer bestimmten Regelung etwas gewinnen oder verlieren würden. Diese Bilanz gibt eine bessere Entscheidungsgrundlage ab als das Einfühlen in eine konkrete Person, die etwas gewinnt oder verliert.
Bloom greift auf eine Unterscheidung zurück, die in Deutschland von Tania Singer vom Max-Planck-Institut für kognitive Neurowissenschaften vertreten wird: Aus ihrer Sicht gibt es neben dem Ein- und Mitfühlen, also der Empathie, noch eine andere Form, die sie mit dem englischen Begriff „compassion“ belegt ( hier ein älterer Bericht des „Tagesspiegel“ dazu ). Wer „compassion“ für einen anderen Menschen hegt, bringt ihm eine Form von Liebe entgegen. Er fühlt nicht dessen Schmerz mit, sorgt sich aber um sein Wohlergehen. Singer untersucht seit einigen Jahren, ob man diese etwas distanziertere Haltung auch trainieren kann. Ihrer Ansicht nach könnte das in Pflegeberufen sinnvoll sein, in denen Helfer mit dramatischen Schicksalen konfrontiert werden.
Paul Blooms steile These ruft aber auch Kritik hervor. Sein britischer Kollege Simon Baron-Cohen von der University of Cambridge (selbst ein Autor populärwissenschaftlicher Bücher) widerspricht Bloom in einer Rezension in der „New York Times“ : Aus seiner Sicht sollte man die Hemmnisse für Empathie beseitigen. Angst, Wut und Propaganda würden verhindern, dass wir mit unseren Gegnern mitfühlen, schreibt Baron-Cohen. Aber wenn es gelingt, den Graben des Misstrauens zu überwinden, dann wird die Welt friedlicher, wenn wir uns gelegentlich fragen, wie es „den anderen“ geht – so Baron-Cohen. Er wolle nicht zwischen „compassion“, Rationalität und Empathie entscheiden müssen. Das seien alles gute Einstellungen.