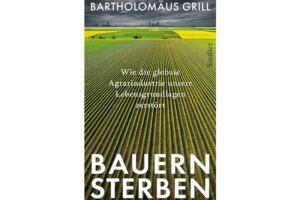Wäre es möglich, dass alle Tiere und Menschen das Sehen erworben haben, indem sich ein vor Millionen Jahren lebender Vorfahre winzige Einzeller einverleibte, die bereits sehen konnten – und deren Gene in sein Erbgut einbaute? In einer schlaflosen Nacht kam Prof. Walter J. Gehring diese – wie er selbst sagt – verrückte Idee, die erklären kann, wie einst das Urauge entstanden ist. „Eine wilde Möglichkeit“, schmunzelt der Genetiker vom Biozentrum der Universität Basel. Eine mikroskopische Aufnahme des einzelligen Dinoflagellaten Erythropsis pavillardi hatte ihn vor Kurzem ins Grübeln gebracht: „Diese Dinoflagellaten haben wunderbare Augen. Obwohl die Mikroalgen nur aus einer einzelnen Zelle bestehen, haben sie alles, was man zum Sehen braucht: Eine Linse, einen Glaskörper, eine netzhautähnliche Struktur und einen Pigmentfleck, der das Licht von einer Seite abschirmt.“ Gehrings Überlegungen fallen mitten in eine erhitzte Diskussion. Seit Jahrhunderten streiten sich Biologen, wie sich die unglaubliche Vielfalt der Augen entwickelt hat. Diese Mannigfaltigkeit brachte Charles Darwin sogar dazu, an seiner Evolutionstheorie zu zweifeln. Er vermutete, wie etliche Forscher noch heute, dass alle Augen auf ein einziges Urauge, auf einen Prototyp, zurückzuführen sind. Andere Wissenschaftler meinen dagegen, dass Augen etwa 40- bis 65-mal unabhängig voneinander entstanden sind, dass die Evolution das Auge wieder und wieder erfunden hat. Paläontologen und Morphologen gelang es bereits vor Jahren, die wichtigsten Schritte der Augenevolution zu rekonstruieren. Mittlerweile haben Genetiker und molekulare Entwicklungsbiologen entdeckt, was sich auf der genetischen Ebene abspielte. Ihre Ergebnisse machten das Bild zwar klarer, doch erstaunlicherweise liefern auch die modernen Methoden Argumente für beide Positionen im Augenstreit. Darin sind sich alle Kontrahenten einig: Die Erfindung des Auges war ein Geniestreich. Ein Organismus, der sieht, ist blinden Artgenossen weit voraus. Denn diese Art der Fernwahrnehmung eröffnet die Möglichkeit, frühzeitig etwa Nahrung oder Feinde wahrzunehmen. „Wer Augen hat, kann in die Zukunft sehen“, meint Wissenschaftsautor Volker Arzt. „Das ist sicher etwas überspitzt formuliert, aber wenn ich sehen kann, was auf mich zukommt – ein Tier mit riesigen Klauen zum Beispiel –, dann weiß ich, was mir in naher Zukunft droht.“ Alle Augen haben ein Ziel: das Einfangen von Lichtteilchen, von Photonen. Darin sind sie zwar unterschiedlich gut, die meisten Augen sind jedoch an ihren Besitzer und seine Lebensweise angepasst. Schnecken sehen mit ihren primitiven Grubenaugen alles, was sie zum Überleben brauchen – zum Beispiel eine bedrohlich nahe Igelschnauze. Da sie sich nicht schnell bewegen, müssen sie gar nicht exzellent sehen können. Trotzdem kann jede kleine zufällige Veränderung des Sehorgans Vorteile gegenüber Artgenossen bringen und so die Überlebenschance steigern. Manchmal ermöglicht ein verbessertes Auge sogar, aus einer Umgebung auszubrechen und neue Gefilde zu erobern. Eine Schnecke, die besser sehen kann, würde Feinde früher erkennen und sich umgehend in ihr Haus zurückziehen. Sie könnte sich daher eher aus den Büschen auf offenes Gelände wagen als ihre weniger gut sehenden Artgenossen. Die ersten Augen entdeckten Forscher bei etwa 540 Millionen Jahre alten Fossilien. „Auch vorher, im Präkambrium haben wahrscheinlich schon Organismen mit so etwas wie Augen gelebt“, glaubt Gehring. Dies könne etwa ein dem Dinoflagellaten ähnlicher Einzeller mit einem Sehorganell oder ein mehrzelliges Lebewesen mit Augenprototyp gewesen sein. Vor etwa 540 Millionen Jahren besiedelte während der Kambrischen Explosion eine Fülle neuer Arten die Erde, und dieser Prototyp konnte sich schnell in viele Richtungen entwickeln. Bereits die Trilobiten – gepanzerte Gliedertiere – besaßen komplexe Facettenaugen. Die Entwicklung ging vermutlich deshalb so schnell, weil die Erfindung des Auges ein regelrechtes Wettrüsten angezettelt hatte. Sehende Räuber konnten ihre Beute schnell und sicher finden. So brauchten die Beutetiere ebenfalls bessere Sicht, um ihnen entkommen zu können. Vor etwa 440 Millionen Jahren, im Ordovizium, gab es bereits alle großen Tierstämme und damit alle heute existierenden Augentypen. In gerade 100 Millionen Jahren schaffte es die Evolution, aus einem einfachen lichtempfindlichen Fleck die ganze heutige Palette der Augen zu kreieren. Es gibt heute noch nahezu alle Übergangsformen, was die Rekonstruktion der damaligen Geschehnisse erleichtert. Einzeller wie das Augentierchen Euglena besitzen lediglich einen lichtempfindlichen, einseitig abgeschirmten Fleck. So können sie erkennen, wo sie Licht finden, das sie für die Photosynthese brauchen. Ein blind durch die Ursuppe der Meere dümpelnder Einzeller müsste lange ziellos umherirren, bis er zufällig Licht findet. Euglena schwimmt einfach in Richtung Helligkeit. Die einfachsten Sehorgane bei Mehrzellern verdienen die Bezeichnung Auge kaum. Viele Seesterne und andere wirbellose Tiere sehen mit einzelnen Lichtsinneszellen, die auf der gesamten Körperoberfläche verteilt sind. Der Seestern kann damit immerhin hell und dunkel unterscheiden – besser als völlig blind zu sein, ist das allemal. So kann er den Schatten eines Räubers sehen und sich im Sand vergraben. Irgendwann gab es dann ein Tier, bei dem sich die bis dahin einzeln verteilten Zellen zu Gruppen zusammenschlossen. Der Vorteil: Nun konnte das glückliche Exemplar die Richtung des Räubers einschätzen – wenn auch nur sehr grob. Quallen etwa besitzen solche Flachaugen, mit denen sie vor über 500 Millionen Jahren einen neuen Lebensraum besiedeln konnten: Sie eroberten die dritte Dimension des Wassers, das offene Meer. Eine kleine Veränderung reichte aus, um das Quallenauge weiter zu verbessern. Wenn ein Flachauge in seiner Mitte ein wenig in die Oberfläche der Haut einsinkt, entsteht ein kleine Grube. In dieser Grube können Lichtteilchen, die aus einer bestimmten Richtung kommen, nicht mehr alle Sinneszellen erreichen. Das Richtungssehen verbessert sich. Diese so genannten Grubenaugen, wie sie heute noch verschiedene Napfschnecken besitzen, können noch kein genaues Abbild der Umgebung vermitteln. Die Schnecke sieht die Welt verschwommen, wie durch Milchglas. Aber wenn die Grubenöffnung nach und nach kleiner würde, könnte das Auge die Umwelt immer ein wenig schärfer auf der Netzhaut abbilden, bis schließlich nur ein kleines Loch übrig bleibt und ein relativ scharfes Bild entsteht. Der Nachteil: Das Bild eines solchen Lochauges ist sehr dunkel. Doch Nautilus, ein lebendes Fossil und ein Verwandter der Tintenfische, sieht seit Jahrtausenden damit. Für seine Lebensweise scheint es die optimale Lösung zu sein. Mit dem Lochauge hatte sich die Evolution scheinbar festgefahren – entweder konnte ein Tier hell, aber unscharf oder scharf, aber dunkel sehen. Für das Problem ergab sich eine elegante Lösung aus einer Struktur, die ursprünglich einen ganz anderen Zweck erfüllte: Ein Tier mit Lochauge entwickelte eine durchsichtige Schicht über seiner Augenöffnung, die vor Dreck schützte. Die kleine Neuerung barg unerwartete Möglichkeiten, denn schon geringe Veränderungen dieser Schutzschicht führten dazu, dass sich das Licht anders an der Augenoberfläche brach und somit mehr Lichtteilchen durch die kleine Öffnung des Lochauges zu den Lichtsinneszellen gelangten. So entstanden die ersten primitiven Linsen. Je größer sie wurden, umso besser war der Effekt: Die Linsen bündeln das Licht und machen so hell und scharf zugleich. Auf diese Weise hat sich das Lochauge des urzeitlichen Nautilus wahrscheinlich zum Linsenauge seines nahen Verwandten, des Tintenfisches, entwickelt. Das Linsenauge war eine geniale Erfindung – so genial, dass es in der Evolution in jedem Fall zweimal erfunden wurde. Das leistungsfähigste aller Augen kommt sowohl bei Tintenfischen als auch bei Wirbeltieren vor – und sieht bei beiden Tiergruppen ganz anders aus. Beim Tintenfisch trifft das ins Auge einfallende Licht direkt auf die Photorezeptoren. Beim umgekehrt aufgebauten Auge des Menschen und aller anderen Wirbeltiere muss es erst verschiedene Zellschichten – die Bipolarzellen und die Ganglienzellen – durchqueren, bevor es die lichtempfindlichen Sinneszellen erreicht (siehe Kasten rechts). Der Grund: Die beiden Augentypen entwickeln sich im Embryonalstadium aus unterschiedlichen Geweben. Die wirbellosen Tintenfische bilden das komplette Auge aus der Haut. Bei den Wirbeltieren entstehen Glaskörper, Netzhaut und weiterführende Zellen aus dem Nervengewebe, Linse und Hornhaut dagegen aus der Haut. Auf den ersten Blick erscheint dieser „inverse“ Aufbau des Wirbeltierauges unsinnig – stehen doch einige Zellschichten zwischen den Lichtteilchen und den Sinneszellen. Doch er bietet einige Vorteile: Bei gleicher Augengröße passen mehr Sinneszellen ins Auge. Die Blutgefäße können die Zapfen und Stäbchen viel besser erreichen und mit Nährstoffen versorgen. Wie schnell die Entwicklung vom simplen lichtempfindlichen Fleck zum komplizierten Linsenauge gehen kann, prüften Prof. Dan-Eric Nilsson von der Universität Lund in Schweden und seine Kollegin Susanne Pelger mithilfe eines mathematischen Modells. Bei ihren Berechnungen fanden die beiden Biologen heraus, dass aus dem Fleck ein einfaches Fischauge in nicht mal 400000 Generationen entsteht. Das entspricht einem Zeitraum von weniger als einer halben Million Jahre – für die Evolution ein Wimpernschlag. Wahrscheinlich dauerte es also nicht einmal 100 Millionen Jahre – wie Fossilfunde vermuten ließen –, um diese Vielfalt hervorzubringen. Andere Tierstämme verbesserten ihre Sicht auf ganz andere Weise: Insekten, Krebse und einige Ringelwürmer entwickelten ein Komplexauge, auch Facettenauge genannt. Anders als beim Flachauge fanden sich bei ihnen nicht mehrere Lichtsinneszellen zusammen, sondern komplette Uraugen setzten sich nebeneinander und bildeten so ein komplexeres Auge. Ein Libellenauge kann aus 30000 Einzelaugen bestehen. Einen völlig anderen Weg haben manche Muscheln beschritten – sie besitzen Spiegelaugen. Bei der Pilgermuschel trifft ein Teil des ins Auge fallenden Lichtes auf einen Hohlspiegel im Augeninneren, wird von dort zurückgeworfen und landet auf einer davor liegenden Netzhaut. Das funktioniert ähnlich wie bei großen Teleskopen – und damit völlig anders als bei allen anderen Augen. Diese Vielfalt an völlig verschieden gebauten Augen ist für viele Forscher ein Beleg dafür, dass es kaum einen gemeinsamen Ursprung geben kann. „Allein dass Augen von verschiedenen Geweben im Körper gebildet werden, deutet daraufhin, dass sie sich mehrfach entwickelt haben“, meint zum Beispiel Dan E. Nilsson. Walter J. Gehring aber hat vor einigen Jahren eine überraschende Entdeckung gemacht. Er fand heraus, dass ein Gen mit dem Namen Pax-6 eine Art Masterkontrollgen ist, das bei Fruchtfliegen, Mäusen und auch beim Menschen die ganze Kaskade der Augenentwicklung in Gang setzt. Es sagt dem Körper, wie er ein Auge zu entwickeln hat. Ist Pax-6 mehr oder weniger defekt, können keine oder nur verkümmerte Augen entstehen. Umgekehrt tauchen zusätzliche Augen auf, wenn die Genetiker Pax-6 an bestimmten Stellen des Genoms einfügen: Gehring hatte entdeckt, dass sich dieses Gen bei Mensch, Maus und Fliege sehr ähnelt. Es gelang ihm, mit dem Pax-6-Gen einer Maus die Augenentwicklung bei Fruchtfliegen anzuschalten, worauf die Insekten an Fühlern, Flügeln und Beinen zusätzliche Augen bildeten. Es entstanden die fliegentypischen Komplexaugen, da das Maus-Gen lediglich den Prozess der Augenbildung in Gang setzt, nicht aber die Augen selbst bildet. „Mit den Augen an den Fühlern können die Fliegen tatsächlich Licht wahrnehmen“, erklärt Gehring. „Die Nervenbahnen der zusätzlichen Sinnesorgane führen jedoch in das Antennenzentrum des Gehirns – es ist deshalb möglich, dass die Fliegen das Licht ‚riechen‘ können, das auf ihre Antennenaugen fällt.“ Später gelang es den Genetikern auch, mit dem Fruchtfliegen-Pax-6 einem Frosch zusätzliche Augen am Kopf wachsen zu lassen. Inzwischen haben verschiedene Forscher das gleiche Gen in so unterschiedlichen Tiergruppen wie Fröschen, Ratten, Wachteln, Hühnern und Seeigeln gefunden. Pax-6 könnte somit die Informationen enthalten, wie ein Prototyp-Auge zu bauen ist, vermutet Gehring. „Seit dieser Erkenntnis sind die teilweise enormen Unterschiede zwischen den Augen nicht mehr so übergangslos“, sagt Prof. Christoph von Campenhausen, Neurobiologe an der Universität Mainz. „Wir können uns nun die verschiedenen Augen durch kleine Ummischungen im Genom vorstellen – einige Gene werden ausgeschaltet, während andere aufgeweckt werden.“ Gehring glaubte früher aufgrund der völlig verschiedenen Baupläne an einen vielfachen Ursprung des Auges. Seit der Entdeckung von Pax-6 ist er jedoch überzeugt, dass alle Sehorgane auf ein einziges Urauge zurückgehen. Jetzt will Gehring herausfinden, ob auch der Dinoflagellat schon die Information von Pax-6 in seinem Genom trägt und damit als „Prototyp-Kandidat“ infrage kommt. Doch Pax-6 ist für Dan E. Nilsson kein Beweis für ein einmaliges Entstehen von Augen. „Pax-6 ist in alle möglichen Dinge eingebunden, nicht nur in die Augenentwicklung. Außerdem gibt es Quallen, die sehr gut entwickelte Augen haben, aber kein Pax-6.“ Nilsson hat eine andere Idee, wie das Gen vor Millionen von Jahren den Pfad der Erleuchtung betrat: „Pax-6 könnte bei primitiven Tieren die Bildung des Vorderendes mitbestimmt haben, und da Sinnesorgane dort am besten aufgehoben sind, könnte das Gen später für alle möglichen Sinne genutzt worden sein. Ich denke nicht, dass Pax-6 ein Masterkontrollgen ist. Es wurde wohl nur sehr früh für die Augenentwicklung rekrutiert.“ Wäre es möglich, dass vor Millionen Jahren Einzeller den Grundbaustein aller heute existierenden Augen erfunden haben und höhere Organismen sich diese Erfindung zu Nutze gemacht haben? „Nein, das glaube ich überhaupt nicht“, sagt Nilsson. „Dinoflagellaten haben etwas, das wie ein Auge aussieht, aber ich glaube nicht, dass das etwas miteinander zu tun hat. Sie benutzen auch nicht den gleichen Sehfarbstoff wie wir.“ „Das würde ich mir sofort vorstellen können“, sagt dagegen Christoph von Campenhausen. So könnte sich die Fusion abgespielt haben: Ein sehender Dinoflagellat dümpelt durch die Ursuppe und trifft auf einen nicht sehenden Mehrzeller. Der ist groß und stark. Der winzige Einzeller nistet sich bei ihm ein, weil er es dort warm und sicher hat. Dem Mehrzeller ist der Parasit zunächst lästig, doch er merkt irgendwann, dass sein Gast etwas kann, was er nicht kann: Lichtinformationen bekommen. So gewährt er dem nützlichen Schmarotzer Asyl und lernt nach und nach zu verstehen, was sein kleiner Partner sieht – die beiden gehen eine Symbiose ein. Das Team hat zweifelsohne einen enormen Vorteil gegenüber Konkurrenten, die nichts sehen. Was in den ersten 100 Millionen Jahren passierte, als aus einfachen Lichtsinneszellen Augen wurden, davon haben Evolutionsbiologen inzwischen ein relativ klares Bild. Jetzt geht die Forschung in die nächste Runde. Molekularbiologen, Evolutionsforscher und Paläontologen müssen die unzähligen Puzzle-Teile zusammenfügen, um zu verstehen, was in den ersten Augenblicken der Augenentwicklung geschah.
Kompakt
Die Evolution der Augen begann vor etwa 540 Millionen Jahren. Seit etwa 440 Millionen Jahren gibt es alle Augen, die wir heute kennen. Die genetische Steuerung der Augenentwicklung verläuft bei fast allen Tieren gleich. Trotzdem streiten sich die Forscher, ob alle heutigen Augen von nur einem Urauge abstammen. Linsenaugen, wie sie auch Menschen haben, sind die leistungsfähigsten Sehorgane, die die Evolution hervorgebracht hat. Evolution zum Linsenauge Einzelne Sinneszellen Seesterne – wie dieser Golfseestern aus Mexiko – nehmen Licht mit einzelnen Lichtsinneszellen wahr, die über die gesamte Körperoberfläche verteilt sind. Damit können die Meerestiere immerhin erkennen, ob es hell oder dunkel ist. Flachauge Flachaugen bestehen aus Lichtsinneszellen, die sich zu Gruppen zusammengeschlossen haben. Mit diesem Augentyp können beispielsweise Quallen sehr grob die Richtung einschätzen, aus der das Licht kommt. Grubenauge Das Richtungssehen hat sich beim Grubenauge entscheidend verbessert. Licht aus einer bestimmten Richtung kann nicht mehr alle Sinneszellen erreichen. Die Blaugebänderte Napfschnecke besitzt diesen Augentyp. Lochauge Mit seinen Lochaugen sieht der Nautilus die Welt um sich herum relativ scharf. Durch die kleine Öffnung kann jedoch nicht sehr viel Licht ins Auge und damit auf die Netzhaut gelangen. Deshalb wird das Bild recht dunkel. Linsenauge Mit der Erfindung der Linse wurde das Abbild der Umwelt auf der Netzhaut hell und scharf zugleich. Tintenfische, nahe Verwandte des Nautilus, sehen mit Linsenaugen. Auch sämtliche Wirbeltiere haben einen ähnlichen Augentyp.
Cornelia Pfaff